Über Gendersternchen, Wortverbote und ideologisch erpressten Sprachmissbrauch wird viel lamentiert – und doch dringen sie unaufhaltsam immer tiefer ins Deutsche ein. Für Autorinnen und Autoren, die ihre Muttersprache lieben, schwinden die letzten Reservate.
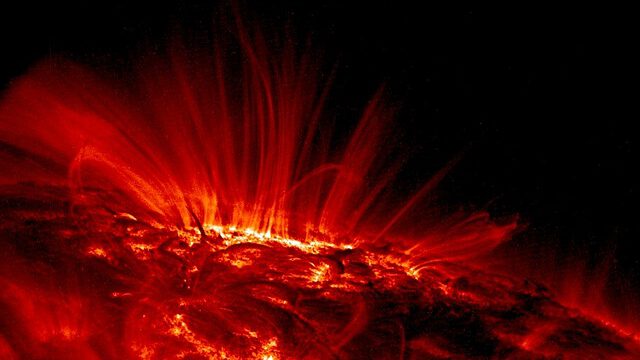
„Sprache sagt alles“, lautet seit einiger Zeit der Slogan des Duden-Universums. Warum ein im Normalfall stocknüchternes, rein sprachsystematisches Nachschlagewerk heutzutage überhaupt einen Werbespruch braucht, wäre auch mal eine Überlegung wert – wenn es nicht wichtigere Probleme gäbe. Eines davon sind die handlungs-, sprach- und denkerziehenden Sachbuch-Angebote des Dudenverlags, über die TWASBO hier bereits berichtet hat. Ihre Zahl und sanfte Militanz ist seither nicht geringer geworden.
Im aktuellen Frühjahrsprogramm des Verlags hat man unter anderem die Auswahl zwischen „Sprachkampf – wie rechte Parteien das Thema Sprache für sich nutzen“, „Überhitzt – was der Klimawandel für unsere Gesundheit bedeutet“, „Die Macht der Sprachen – über Herkunft und Vielfalt“ sowie dem schlichten Titel „Grün“, beworben als „das Buch zum aktuellen Lebensgefühl“. Samt und sonders mit dem neutralen Qualitätssiegel der Duden-Marke auf dem Cover.
Das sagt in der Tat schon alles. Die offizielle deutsche Sprache ist heute eben nicht mehr neutral. Eine sich „progressiv“ gebende Kaste von Umerziehern und Wortwächtern mit handfesten materiellen und politischen Interessen hat sie endgültig als Waffe im Kampf um die Deutungshoheit entdeckt und nutzt sie entsprechend. Die Projektile sind dabei längst nicht nur großkalibrige Bücher. Viel wirkungsvoller in der Breite sind die Millionen Schrotkügelchen der Wörter und Schreibungen.
Sie müssen nur in möglichst viele Köpfe dringen. Am einfachsten geht das bei den Unter-Vierzigjährigen. Dort umschmeicheln Assoziationswolken wie Vielfalt / Toleranz / Offenheit / Gerechtigkeit / Gleichheit / Wandel besonders wirkungsvoll die entsprechenden identitären Selbstbilder. Den Rest erledigt ein teils noch naiver Nachahmungs- und Herdentrieb. Es sind dieselben Altersgruppen, aus denen sich auch die eifrigsten, ja eiferndsten Erfüllungsgehilfen und Einpeitscher des Neusprech rekrutieren.
Jüngstes Opfer der sprachkulturellen Kamikaze-Attacken solcher Kindersoldaten ist das arglose Dörfchen Negernbötel in Schleswig-Holstein. Dem will die Grüne Jugend einen neuen Namen verpassen, da der alte „das sehr verletzende und rassistische N-Wort“ enthalte.
Trotz des über die jungen Leute hereingebrochenen Spotts – der Ortsnamensteil „negern“ ist das plattdeutsche Wort für „näher“ – springt ihnen in den Lübecker Nachrichten ausgerechnet ein Sprachwissenschaftler bei: „Ortsnamen sind nicht heilig, wenn eine Gesellschaft und ihre Werte sich ändern.“ Der Zitierte heißt Antol Stefanowitsch. Von ihm stammt auch das Buch „Eine Frage der Moral: Warum wir eine politisch korrekte Sprache brauchen.“ Erschienen im Duden-Verlag.
Nun waren Sprachwandel und Sprachrebellion schon immer vor allem auch eine Altersfrage. Die „Jugendsprache“ pumpt seit jeher frische, freche, teils kuriose Prägungen und Wendungen in den Wörtersee. Von denen erblicken zwar die meisten nicht das zweite Lebensjahr, aber die den natürlichen Auslesemechanismus überlebenden Neologismen halten die Sprache jung und schützen sie vor drohender Stagnation. In einer immer schneller sich wandelnden Welt ist das im Grunde sehr nützlich. Denn sonst würden uns alsbald die Worte fehlen – Begriffe für Dinge und Phänomene, die es bis dato noch gar nicht gab, nun aber eben doch.
Doch was sich seit einigen Jahren immer schneller und rabiater abspielt, ist etwas anderes. Rein sprachästhetisch gesehen ist es ein „race to the bottom“, bei dem auch die schrecklichsten Verrenkungen nicht mehr durch das Sieb der Sprachlogik oder der Fremdscham fallen, sondern künstlich aufgepäppelt und mit einer höheren Moral aufgeladen werden. Umgekehrt wird aus dem Sprachschatz ausgelöscht und tabuisiert, was auch nur in absurdester und abseitigster Weise als „diskriminierend“ interpretierbar erscheint.

Ihre Ge- und Verbote verbreiten die pressure groups teils offen aggressiv, zumeist aber können sie sich auf schleichend affirmative Befolgung verlassen – bis die Neuerungen den Status des Offiziellen, Alternativlosen, einzig Denkbaren erlangen. Der Trick, dessen sich die neuen politischen Spracherzieher dabei bedienen, ist Angst.
Sie verstärken den Druck auf Kritiker und Skeptiker geschickt mit Botschaften, die mit unsichtbarer Tinte auf den Beipackzettel jeder Neueinführung oder -regelung gedruckt sind: Du willst doch wohl nicht als ewig gestrig gelten? Du wirst doch nicht wie ein Freund von dem rüberkommen wollen? Du wirst doch wohl nicht hinter deine Kunden / Parteimitglieder / Geschäftspartner / Freunde zurückfallen, die Neusprech längst schon ganz alltäglich verwenden? Du willst dich doch weiterhin jung und aufgeschlossen nennen dürfen? Und vor allen Dingen: Du willst doch wegen solcher Kleinigkeiten nicht etwa einen Aufstand machen wollen? Du willst doch nicht deswegen ins Büro der Abteilungsleiterin gerufen werden?
Sind doch nur Wörter. Sind doch nur grammatikalische Konstruktionen. Sind doch nur firmen- und organisationsinterne Memos, Empfehlungen, Richtlinien, Umläufe, Sprachregelungen, Protokolle, Handbücher, Corporate Policies. Sind doch nur Einträge im Duden. Sind doch, am Ende, nur sanktionsbewehrte Sprachkommandos. Denn den abschließenden Teil des Duden bilden mehr als 100 Paragrafen zur „amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung“. Was im vorderen Buchteil noch als Empfehlungen oder Regelungen daherkommt, ist Punkt für Punkt verknüpft mit einem §-Zeichen, einer Ziffer und einem Absatz – ganz wie bei Bundesgesetzen.
Jedes Komma und seine Verwendung sind im amtlichen Teil genormt. Für jeden Beamten und jede Beamtin, jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin des Öffentlichen Dienstes in Kommune, Kreis, Land oder Bund gilt jeder dieser Paragrafen bei jedem öffentlichen Schreiben, das er oder sie zu verfassen hat, als das Wort Gottes bzw. der Göttin: unkritisierbar, unhinterfragbar, unabänderlich. Insbesondere für jede Lehrerin und jeden Lehrer.
Auch in dem immer wahrscheinlicheren Fall, dass er oder sie die richtige Schreibung gar nicht mehr beherrscht und trotzdem nicht nachschlägt: Im Zweifel kann es eines Tages materielle Konsequenzen nach sich ziehen, wenn die Gendersternchen vergessen werden, die schon in einer der nächsten Auflagen des Duden (und damit der amtlichen Rechtschreibung) bundesweit Gesetz werden könnten. Ganz zu schweigen von hochnotpeinlichen Shitstorms auf Twitter und Facebook, die solch ein amtlicher Sprachfrevel womöglich auslösen würde.
In den letzten beiden Absätzen bin ich probeweise von der altsprachlichen Gewohnheit abgewichen, dass die männliche Form die weibliche Option im Zweifelsfall einschließt und mitbedenkt. Wie ermüdend und stillos sich all die daraus resultierenden Verdoppelungen lesen! Dafür habe ich die Selbstverständlichkeit hergebetet, dass die meisten von Männern aufgeführten Bühnenstücke des Lebens auch in weiblicher Besetzung möglich sind und umgekehrt, ja sogar gemischtgeschlechtlich. Hilft aber nichts, denn ich habe nun immer noch die Selbstdefinierten diskriminiert.
Moment, werden die Neusprecher einwenden: Statt solcher Satzungetüme schreiben wir ja jetzt auch sehr viel eleganter und allumfassend „Lehrende“ als Alternative zu „Lehrerinnen und Lehrer“. Bloß: Lehrerin und Lehrer sind Berufsbezeichungen, die 24 Stunden am Tag zutreffen. Abends in der Kneipe aber lehren der Lehrer und die Lehrerin nicht, weshalb das Präsenspartizip „lehrend“ nur zu Situationen passt, in denen sie tatsächlich vor der Klasse stehen und lehren.
Auf den gemeinsamen Kneipenabend angewendet, formuliert es sogar offensichtlich eine Unwahrheit, das Gegenteil des wirklichen Sachverhalts. (Dort müsste es eher „Trinkende“ heißen.) Der Duden aber lässt das Partizip zum „substantivierten Adjektiv“ mutieren, eben zu „Lehrende“. Das Adjektiv „lehrend“, das dieser Konstruktion angeblich zugrundeliegt, kennt jedoch nicht einmal er selbst. Anders als beispielsweise das tatsächliche Adjektiv „bedeutend“, das ja auch unzweifelhaft ganztägig gilt.
Trick 17 mit Selbstüberlistung also. Aber die Duden-Kommission, man kann es geradezu mit Händen greifen, wollte diese handwerklich grundschiefe Konstruktion unbedingt legalisieren, um dem „korrekten“ Gendern nachzuhelfen. Was nicht passt, wird passend definiert. Ob die Eigendynamik der Sprachentwicklung diese Richtung nehmen wollte oder nicht. Ob der Autor (Autierende) Driesen davon Schrei(b)krämpfe kriegt oder nicht.

Und damit sind wir also beim * angelangt, der bislang strahlendsten Monstrosität, die in absehbarer Zeit auf den Duden-Schild sprachlicher Norm gehoben werden dürfte. Die Sprachkommission des Duden bietet im Netz eine Stilberatung an, gerade auch zum wunderschön gekoppelten Stichwort „geschlechtergerechter Sprachgebrauch“ (ich wollte, es gäbe einen Superlativ „am geschlechtestengerechtesten“). In dieser Online-Sprechstunde heißt es derzeit noch, das Gendersternchen sei „vom amtlichen Regelwerk nicht abgedeckt“.
Doch wenige Zeilen weiter wird der Kurswechsel schon vorbereitet: „Es ist zu beobachten, dass sich die Variante mit Genderstern in der Schreibpraxis immer mehr durchsetzt.“ Und was sich immer mehr durchsetzt, klar, das wird eines Tages die Norm, die man einfach nicht umhinkann zu kanonisieren.
Diese Zukunftsnorm soll in den Augen der Sprachregulierer die Rettung vor dem selbstverschuldeten Kategorien-Wirrwarr und endlich auch die große, goldene Sprachgerechtigkeit bringen. Schon heute liest man auf Tausenden von Webseiten bei Unternehmen, Parteien und Verbänden Konstruktionen wie „Unser Selbstverständnis als Planer*innen, Architekt*innen und Ingenieur*innen“. Nun ist aber das Deutsche keine Bilderschrift wie etwa das chinesische Mandarin. Ein Stern-Symbol hat daher keinen unmittelbaren Bedeutungsgehalt (außer „Stern“). Es wirkt inmitten von Buchstaben so fremdartig, wie es gekünstelt ist – und sorgt auch noch für grammatikalische Problem-Tsunamis.
Wenn sich etwa im oben zitierten Beispiel die männlichen Angehörigen dieser drei Berufsgruppen ebenso gemeint fühlen sollen wie die weiblichen: Wo genau finden sie sich da wieder? Lassen die Männer beim Lesen im Geiste den pluralen Feminisierungspartikel *inn fortfallen, dann heißen diese Herren jetzt in ihrer nominativen Mehrzahl „Planeren, Architekten und Ingenieuren„. Denken sich die Leser aber stattdessen das *innen komplett weg, dann sind sie „Planer, Architekt und Ingenieur“ – von jeder Sorte nur einer, während die Kolleginnen viele sind. Kann ja sein, dass es zufällig stimmt.
Den Grundsatz „eine Regel für alle Fälle“ können wir damit allerdings vergessen. Schlimm unlogisch, übel dysfunktional, optisch Blutgerinnsel auslösend. Aber aus Sicht der Geschlechterverfechter unbedingt allen Deutschsprechenden zumutbar, „wenn’s der Wahrheitsfindung dient“ (Kommunarde Fritz Teufel 1967 in anderem Zusammenhang).
Doch der Befriedigung aller identitätspolitischen Gruppeninteressen dient das ebensowenig wie dem gesellschaftlichen Sprachfrieden. Als die Stadt Hannover Anfang 2019 als erste deutsche Großstadt einen offiziellen, verbindlichen Verwaltungssprachleitfaden mit Sternchen und allen anderen die Logik lähmenden Strahlenwaffen einführte, war der öffentliche Unmut beträchtlich – größer jedenfalls, als die linksliberalen Leitmedien geahnt hatten. Wie aber handelte die Süddeutsche Zeitung diese Aufwallung des gesunden Menschenverstands ab? In zwei sarkastisch-herablassenden Sätzen: „Natürlich hagelt es den in Genderfragen üblichen Hohn, vor allem im Netz (‚Gendergaga‘). Nicht jeder schätzt sprachliche Feinheiten und Entwicklungen.“
Hallo, hier, ich schätze die! Und genau deshalb deprimiert es mich als jetzt gerade Schreibenden zusätzlich, dass auch in andere Sprachräume der gutgemeinte Unfug eingebrochen ist. Wie zum Beispiel die erst in Zeiten der „gender neutrality“ voll ausgebrochene englische Krankheit, für eine einzelne Person zur Diskriminierungsvermeidung den neutralen Plural zu verwenden: „The person left a note on the kitchen table saying that they were going to kill themselves.“ Es war aber kein Massenselbstmord, sondern ein persönlicher Suizidversuch. Sowie auch ein grammatikalischer.
Hierzulande schwinden derweil die Ökosysteme, in denen Liebhaberinnen und Liebhaber (!) der deutschen Sprache noch frei von unmöglichen semantischen Verrenkungen und Kotaus vor jeder nur vorstellbaren Minderheit publizieren können. Schon die Generation der heutigen Schulabgänger wird in ihren Bewerbungsschreiben ganz selbstverständlich die Sternchenform verwenden – schon weil es nicht zu tun einen Papierkorb-Algorithmus triggern könnte, noch bevor die Personalchefin auch nur die Chance hätte, „offended“ zu sein.
Auch der erste deutschsprachige Roman, in dessen Manuskript die Handlungsfäden durchgängig gegendert und alle potenziellen Rassismen selbst aus Dialogzeilen von Mafia-Paten und -patinnen entfernt wurden, wartet vermutlich nicht erst auf die Druckfreigabe. Er dürfte schon in den Regalen stehen. Weltliteratur kann daraus ja trotzdem noch werden – in der russischen Übersetzung.
Der Form jedenfalls wurde Genüge getan, das richtige Denken vorgezeigt, die waidwund geschossene Grammatik ächzt und stöhnt, die partiell noch mögliche Schlichtheit und Klarheit der deutschen Sprache liegt am Boden. Diese stumpfe Gewaltanwendung geschieht an vielen Orten und aus vielen Gründen: in bester Absicht, aus blankem Umerziehungswahn, um die Einheitlichkeit mit anderen Texten herzustellen, weil die Kundschaft das angeblich so erwartet, aus Feigheit, oder einfach weil … das heute eben so ist.
Aber unter all den Schrullen einer zunehmend verstrahlten Sprache hat wenigstens das Partizip-Gendern („Lehrende“) doch ein Gutes: Fliesenleger kommen dadurch zu ganz neuen Ehren. Auch dieser körperlich so beschwerliche Beruf darf ja nicht das tatsächliche und sprachliche Privileg von Männern bleiben. Weil Fliesenlegerbetriebe aber nun mal oft noch rein männliche Belegschaften haben, sind auch Jupp und Willi Kowalski jetzt Fliesen-Legende. Und das schon zu Lebzeiten. Respekt!


Hinterlasse einen Kommentar