Die einflussreiche New York Times ist auf dem Weg von „liberal“ nach „links-identitär“ in der entferntesten Ecke angekommen: Das Blatt, das angeblich zur Heilung der tief gespaltenen USA beitragen will, hat sich einer Hierarchie der Hautfarben verschrieben.
Anfangs habe ich es lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen. Dann, als ich das erste Mal darüber stolperte, hielt ich es für einen Rechtschreibfehler. Aber ich bin nicht so firm im Amerikanischen, dass ich mir sicher sein konnte. Ich sah also in einem der einschlägigen Wörterbücher nach, und ja: Es musste ein Schreibfehler sein. Doch dann entdeckte ich denselben Fehler ein zweites Mal. Und ein drittes. Und viertes. Der Fehler war überall. Erst da dämmerte es mir allmählich: Dies war keine Schlampigkeit der New York Times. Dies war Politik.
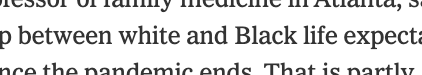
Die New York Times, die vielleicht bekannteste und renommierteste Newspaper-Marke der Welt, schreibt seit Mitte vergangenen Jahres „Black“ groß und „white“ klein. Die Zeitung, deren offizielles und jeden Tag im Kopf der Printausgabe abgedrucktes Credo seit September 1896 „All the news that’s fit to print“ lautet, also „Alle Neuigkeiten, die es wert sind, gedruckt zu werden“.
Die neue Hautfarben-Schreibweise ist ein Vorgang, der mir nicht nur als Journalist, sondern auch als Staatsbürger mit einigermaßem wachem Verstand so fremd ist, dass er mir selbst jetzt, nach ausgedehnter, bewusster Beschäftigung damit vorkommt wie ein peinlicher Irrtum, ein Versehen, das vielleicht unter Drogeneinfluss passiert. Etwas, das man entschuldigen kann, dann aber besser schnell Gras darüber wachsen lässt. Nur: Hier wächst kein Gras mehr. Hier ist journalistisch und ideologisch verbrannte Erde.
Als ich die Times deswegen kontaktierte, verwies mich „news assistant“ Alain Gardiner auf diesen Nabelschau-Artikel aus dem vergangenen Jahr:

Tatsächlich muss sich erklären, wer die schwarze Hautfarbe entweder für substanzieller als die weiße zu halten scheint oder die Schwarzen für so schwächlich, dass er sie mit dem Geschenk eines Großbuchstabens künstlich aufpäppeln zu müssen glaubt. Aus dem Times-Text soll denn auch zweierlei hervorgehen: warum das Adjektiv „schwarz“ im Fall der Hautfarbe großzuschreiben sei – und weshalb „weiß“ dennoch kleingehalten werden müsse. Fangen wir mit dem großen B an.
Auslöser für die sprachliche Erhöhung alles Schwarzen sei der Tod von George Floyd unter dem Knie eines weißen Polizisten gewesen, der das Land erschütterte. So jedenfalls Mike Abrams, „senior editor for editing standards“, in dem Erklärstück. Seit damals hätten auch andere News-Organisationen wie etwa die Nachrichtenagentur Associated Press dieselbe Neu-Schreibweise eingeführt. Nicht unbedingt ein starkes inhaltliches Argument: Andere machen es doch auch.
Dann aber folgt ein merkwürdiger Gedankengang, beigesteuert von Inlands-Ressortleiter Marc Lacey: „Für viele Menschen bedeutet die Großschreibung dieses einen Buchstabens den Unterschied zwischen einer Farbe und einer Kultur.“ Es gibt demnach nicht nur eine gemeinsame afro-amerikanische (was noch nachvollziehbar wäre), sondern eine allgemein schwarze Kultur – unabhängig davon, in welchem Kontinent oder Land jemand mit dunkler Hautfarbe lebt, geboren wurde oder seine Vorfahren verortet.
Warum? Weil alle Schwarzen, über genügend viele Generationen betrachtet, gemeinsame afrikanische Wurzeln haben? Aber haben wir die nicht alle, als Menschheit? Demzufolge müssten wir alle Black sein. Und diese Black Culture demnach ein recht eintöniges Ding. Von kulturellen Eigenarten Nigerias oder Detroits bittet die Times offenbar im Sinne von „Black“ Abstand zu nehmen.
Vieldeutig wird es dann bei der Erläuterung der Absichten, die mit der neuen Sprachregelung verfolgt werden. Dieselbe ist jetzt Teil des „Stylebooks“, des Times-Handbuchs der politisch korrekten Zeitungssprache. „Wir möchten das Stylebook nicht als Instrument des Aktivismus verstanden wissen“, erklärt Mike Abrams. Nicht, aha. „Wir sehen es nicht als die Speerspitze der Sprache.“ Auch das nicht, so so – obwohl die kriegerische Metapher hier fast freudianisch verwendet wird. „Wir wollen ganz allgemein, dass das Stylebook den allgemeinen Sprachgebrauch reflektiert.“ Wenn es genau das aber offensichtlich nicht tut, dann muss die Penetrierung per Dekret dafür sorgen, dass es irgendwann vielleicht doch so weit kommt.
Aber gut. Nehmen wir das alles mal so hin. Es hat ja vorderhand niemand Nachteile davon, dass „schwarz“ nun „Schwarz“ geschrieben wird. Warum jedoch „weiß“ weiterhin „weiß“? Das erst ist ja der eigentliche Zündstoff: die Ungleichbehandlung zweier Hautfarben in einer der einflussreichsten Zeitungen der Welt. Hier tritt nun eine Dialektik auf den Plan, die es schafft, offentsichtlich Widersprüchliches ganz wie in der ehemaligen DDR sprachlich ins Gegenteil zurechtzubiegen, bis es wieder ins Weltbild passt. Denn „weiß repräsentiert keine gemeinsame Kultur und Geschichte, wie es Schwarz tut“.
Meines Wissens teilten die Siedler, die sich den Kontinent gewaltsam untertan machten und 1776 die USA gründeten, durchaus eine gemeinsame weiße Hautfarbe und Kultur. Beide hatten sie auch mit nachfolgenden Wellen europäischer Einwanderer gemein. Bedeutende Einflüsse dieser Epochen schlagen sich bis heute als die Kultur der WASP (White Anglo-Saxon Protestants) in den verschiedensten US-amerikanischen Lebensbereichen nieder, von der Architektur über die evangelikale Religion bis hin zum Kapitalismus selbst. Und gerade deshalb, weil diese Kultur als „typisch weiß“ gilt, wird sie ja von Blättern wie der New York Times zunehmend heftig attackiert. Was die Zeitung nach ihrer eigenen neuen Sprachlogik mithin gar nicht tun dürfte – aber in dem heiligen Krieg für das Gute / Schwarze, in dem sich die Redaktion offenbar sieht, eben doch tun zu müssen glaubt.
Doch selbst wenn eine beliebig große Kohorte weißer Menschen eine gemeinsame Kultur haben sollte, genügt das laut New York Times nicht für „White“. Denn diese Großschreibweise würden gewohnheitsmäßig extremistische Gruppen weißer Schwarzen-Hasser verwenden. Mit anderen Worten: Sie ist bereits von den Bösen „besetzt“. Bloß gut, dass extremistische Gruppen schwarzer Weißen-Hasser – die es natürlich nicht gibt – nicht gewohnheitsmäßig „Black“ schreiben. Hoffen wir, dass sie durch die neue suprematistische Schreibweise der Times auch nicht dazu ermutigt werden.
Glaubt man den veröffentlichten Online-Leserkommentaren, lösten all diese Rechtfertigungsversuche der Times vielfach zweierlei aus: Verwirrung und Kopfschütteln. Ein Leser des Erklärstücks schrieb in seinem Kommentar, den die übrigen Kommentatoren mit Abstand am zahlreichsten favorisierten: „Warum müssen Linke [Liberals] immer so dumm sein? Indem sie immer überreagieren, verlieren sie die Legitimation, die sie verdienen. Den Gemäßigten, auf die sie für politische Veränderung angewiesen sind, geben sie damit Gründe, ihnen nicht zu folgen. Sie stellen sich wieder und wieder selbst ein Bein.“
Jemand namens Kim, selbst dunkelhäutig, ergänzte in einem ebenfalls hundertfach geliketen Leserkommentar: „Ich habe die Argumente für die Großschreibung gelesen. Sie überzeugen mich nicht und ich werde mich und meine Leute und unsere Geschichte und Kultur weiterhin als ’schwarz‘ bezeichnen. Ich will keine unnötigen Großschreibungen. Und verbessern Sie mich nicht, wenn ich weiterhin ’schwarz‘ schreibe.“
„Black and White, unite, unite!“ – So soll es laut einem Song Wolf Biermanns auf dem Pappschild des Briefträgers William L. Moore gestanden haben, der damit im Jahr 1963 demonstrierend durch die von den Bürgerrechtsunruhen erschütterten Südstaaten zog. In neuer Schreibweise würde dem Schild eine gewisse Unglaubwürdigkeit anhaften. Ebenso wie einem Journalismus, der sich angeblich der „Heilung eines tief gespaltenen Landes“ verschrieben hat.
Es ist erst drei Jahre her, dass ich die New York Times in einem Blogtext wegen ihrer weltumspannenden und detailgenauen Recherchierfreude als journalistischen Goldstandard pries – zumal im Vergleich zu deutschen Provinzblättern wie dem Hamburger Abendblatt, das von der Times damals sogar in seinem eigenen Hinterhof überholt und vorgeführt wurde. All the news that’s fit to print.
Doch in drei Jahren ist eine Menge passiert. Nicht nur ist George Floyd in den USA heiliggesprochen und mit einer medialen Inszenierung, die ich bis dahin nicht für möglich gehalten hätte, in einem goldenen Sarg beigesetzt worden. Die New York Times hat inzwischen auch einen hausinternen Religionskrieg um das stragegisch bedeutende Meinungs-Ressort hinter sich. Dabei wurde unter anderem die damalige Op-Ed-Redakteurin Bari Weiss wegen ihrer Bemühungen um einen Binnenpluralismus der veröffentlichten Meinungen von zumeist jüngeren, in die Reaktion nachgerückten Kollegen mürbe gemobbt. In einem erschütternden Rücktrittsbrief legte sie die Gründe für ihre Resignation (im doppelten Sinne) dar.
Einen Monat zuvor, im Juni 2020, hatte bereits der langjährige Ressortverantwortliche James Bennet seinen Hut nehmen müssen, nachdem rund 1000 Mitarbeiter des Verlags gegen seine Veröffentlichung eines Kommentars des republikanischen Senators Tom Cotton protestiert hatten. Cotton hatte in dem Meinungsbeitrag gefordert, Soldaten als letztes Mittel gegen damals ganze Innenstädte in Schutt und Asche legende BLM- und Antifa-„Aktivisten“ einzusetzen.
Im mitterweile bei der Times durchgesetzten Meinungsklima und angesichts der erzwungenen Neuschreibweise des Adjektivs „schwarz“ können die Inhaber der nunmehr großgeschriebenen Hautfarbe naturgemäß kein Wässerchen trüben. Entsprechend wimmelt es nun vor Artikeln, in denen Schwarze ausschließlich in einer oder mehreren von drei Rollen in Erscheinung treten: als Opfer, Ankläger oder inspirierendes Rollenvorbild. Der Verherrlichungs-Tsunami entspricht in seiner Intensität, nur umgekehrt, ganz der Flut an geradezu hasserfüllten Times-Artikeln während der gesamten Regentschaft Trumps. Bis zu 20 Meinungsartikel pro Tag stellten den US-Präsidenten und seine alten weißen Männer als amtierende Teufel vom Dienst dar – ohne auch nur eine einzige entlastende Gegenstimme.
Dieser bipolare Journalismus kennt nur noch Halunken und Heilige – und er kennt vor allem nur noch Lager, Gruppen und kollektive Identitäten. Die Gruppenzugehörigkeit wird eingangs abgefragt, und von da an läuft die Meinungsmaschine ungebremst entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ungestört auch von be- oder entlastenden Fakten im Einzelfall, über den angeblich berichtet wird. Das ist die eigentliche Schreckensherrschaft der „Identitätspolitik“, die sich seit Jahren im linksliberalen US-Spektrum austobt. In einem Land, das ohnehin zeitweilig an der Grenze zum Bürgerkrieg entlang ethnischer Linien taumelt, zündelt sie noch zusätzlich mit der Militarisierung von Sprache und Schreibweisen.
Nun könnte man sagen: Was geht es uns an, wenn die USA über eskalierende Rassenprobleme die Rechtsschreibung ändern. „Rassen“ gibt es ja in der deutschen Sprache ohnehin nicht mehr, oder richtiger: Sie sind als „rechter Kampfbegriff“ beängstigend und daher nicht mehr salonfähig. Peinlich genug, dass sie für die Vereinigten Staaten ausgesprochen real zu sein scheinen. Aber schon diese Verunmöglichung eines für sich genommen wertfreien Begriffs zeigt, dass der publizistische Zug bei uns längst in dieselbe Richtung rollt wie jenseits des Atlantiks: Die Verfechter der linksliberalen bis linksextremen Identitätspolitik versuchen mit zunehmender Macht, über die Normierung und Umformung von Sprache ein „richtiges“ Denken zu erzwingen.
„Böse“ Begriffe soll es nicht mehr geben, damit sie nicht mehr gedacht werden können. „Gute“ Begriffe gilt es zu penetrieren, neu mit Bedeutung aufzuladen, alternativlos zu machen. Nicht zufällig fühlte sich einer der Leser-Kommentatoren unter dem Erklärstück der New York Times an die normierte und manipulierte Amtssprache „NewSpeak“ aus Orwells „1984“ erinnert. Als deutsche Variante der NewSpeak erscheint etwa die unsägliche Sternchen-Schreibweise in der „Gender“-Debatte, die der gewachsenen deutschen Sprache komplett zuwider läuft und ihre Grammatik ad absurdum führt. Doch wenn allein mit sprachlich-grammatikalischen Mitteln sogar neue Wertordnungen durchgesetzt werden können, wie etwa „Schwarz ist etwas Größeres als weiß“, dann kommt das den neuerdings überall in den Redaktionsstuben inthronisierten Spracherziehern gerade recht.
Ist das neue sprachliche Dogma erst etabliert, weil es etwa bereitwillig vom Duden übernommen wurde, dann lässt sich damit herrlich Macht ausüben. Menschen in Behörden etwa können per Hausvorschrift dazu gezwungen werden, es im Schriftverkehr anzuwenden. Journalisten ebenfalls. Allerdings regt sich bei mir in diesem Fall aufs Heftigste die Reaktanz, über die ich hier kürzlich erst geschrieben habe und die ein geistiger Schutzmechanismus bei ideologischer Vergewaltigung ist. Künftig kostet meine Reaktanz die New York Times ein paar Dollar pro Monat.
Die Ironie dieser tieftraurigen Geschichte: Als ich nun mein Digital-Abo kündigte, musste ich mich durch eine Phalanx von Nachfragen und Bettelaktionen klicken, die mich vom Abbruch der Zahlungsbeziehung abbringen sollten. Unter anderem wurde ich ausführlich nach Gründen befragt, die ich geduldig wiederholte: Ein Blatt, dass sich selbst ohne Not so sehr in eine Ecke hineinmanövriert hat, dass Hautfarben eine typographische Hierarchie erhalten, kann nicht länger mein Weltbild mitgestalten.
Doch kurz vor meiner Entlassung als Abonnent stand ein weiterer Online-Fragebogen der Times, die ein letztes Mal alles über ihren zukünftigen Ex-Leser wissen wollte:
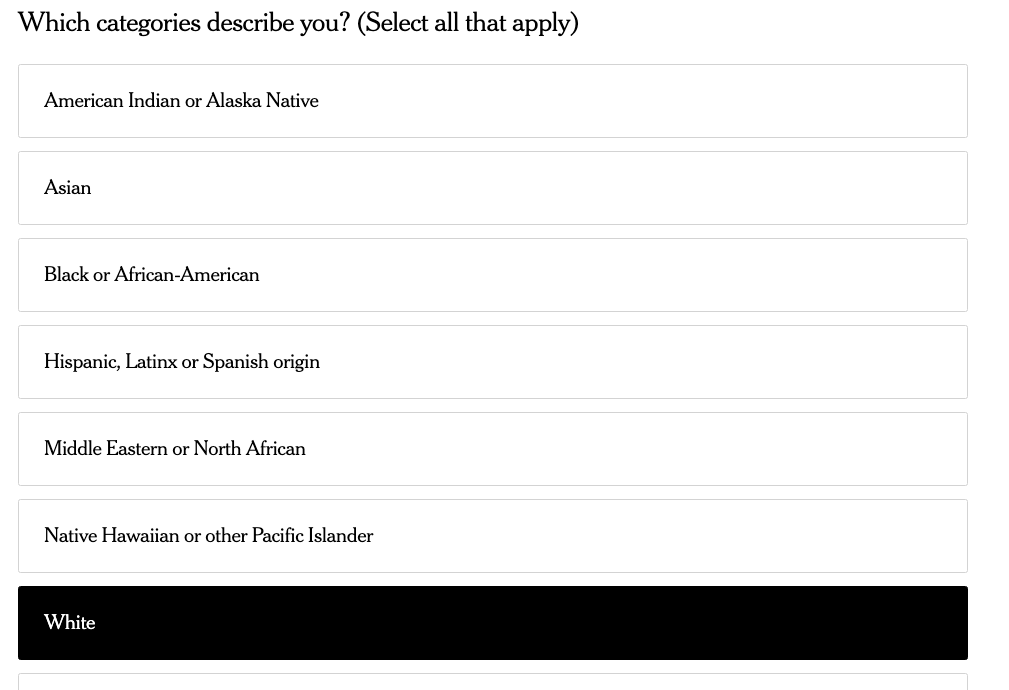
Und da dachte ich: Schau an, die Gleichbehandlung funktioniert ja doch noch! Leider nur beim Abschiednehmen.


Symbolisches politisches Handeln bringt in der Öffentlichkeit mehr Credit-Points als die Orientierung an publizistischen Standards. Das ist nichts neues. Die Springerpresse hat das ja mit den Gänsefüsschen bei der Nennung des „sozialistischen Gebildes“ vorgemacht. Es ist auch nicht falsch, wenn eine Zeitung die Welt von einer selbstgebauten Warte aus betrachtet. Es reicht, wenn für die Leser jederzeit erkennbar ist, wo die Warte steht. Er kann sich seine Meinung dann schon selber bilden. Zeitungen sollen und müssen eine Position haben, ansonsten gäbe es wohl kaum ein Motiv publizistisch zu arbeiten. Im schlechtesten Fall will der Leser lesen, was er ohnehin schon weiss, der Schreiber will die Welt erklären und der Verleger will dabei auf ein einträgliches Geschäft hoffen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dies bei der NYT jemals anders gewesen ist. Dass jetzt ein großes „B“ vor „black“ gemalt wird, ist da nur konsequent, denn um dieses Spiel erfolgreich weiterzuspielen macht man Konzessionen an die herrschende Auffassung in der Leserschaft. Wobei – da kann man schon mal Fragen, ob die herrschende Auffassung die der Leser oder doch eher die der redaktionellen Blase ist. Ärgerlich aber, wenn Medien die Standards der journalistischen Arbeit als Monstranz vor sich hertragen und sie gleichzeitig durch das, was sie „Haltung“ nennen, untergraben. Dass dies nicht lange gut gehen kann, haben Leser immer begriffen. Das Ideal der Presse ist die kalte Hundeschnauze: sie ist unbestechlich und will niemandem gefallen. So steht es jedenfalls in den Statuten. In den Charts der Anzeigenabteilung und den Scores der Webanalysen steht etwas anderes. Es gibt ausserdem nicht viele Journalisten, denen es egal ist, ob sie gut ankommen oder nicht.
Zwei Fragen bleiben:
„Unite, unite“ – der Briefträger Moore dachte selbstverständlich an die Einheit der Klasse und eben nicht an Rasse oder Geschlecht, als er das auf sein Schild schrieb. Die Identitätspolitik ist das genaue Gegenteil davon, denn sie spaltet. Ist es ein Zufall, dass die identitären Spielarten der politischen Kommunikation bei den liberalen Bildungsbürgerkindern genau so beliebt sind, wie bei den gut situierten Intellektuellen der äussersten Rechten?
Die bei der NYT und anderswo greifende Dialektik ist eine moralische. Sie fragt nicht nach Widersprüchen, sie fragt nach Haltung und teilt die Welt in gut und böse. Was soll daran links sein?